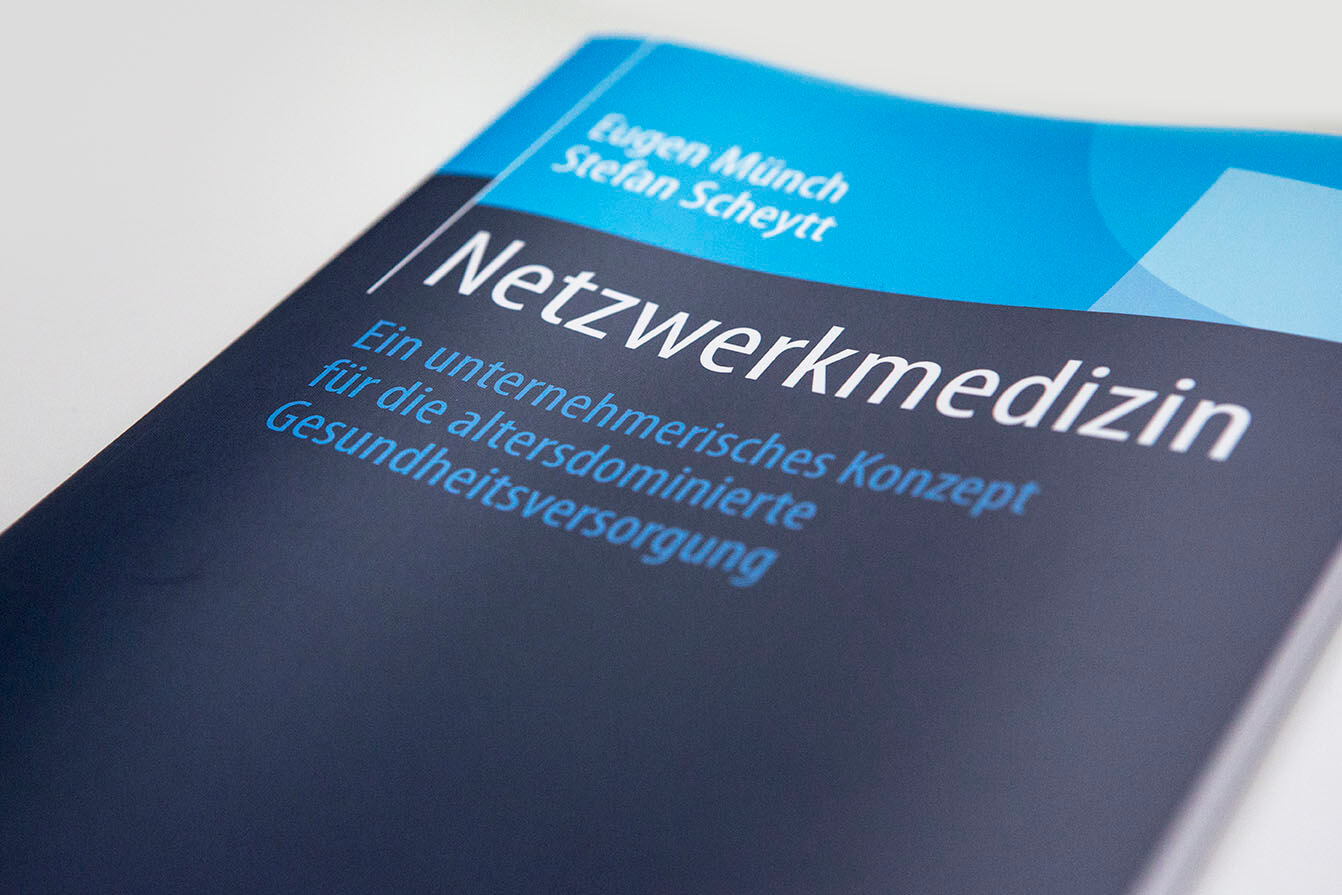Qualitätsstandards bei Ambulantisierung und tagesstationärer Behandlung
Anforderungen an Qualitätssicherung und Patientensicherheit in Krankenhaus und Gesundheitspolitik
Rhön Stiftung (Hrsg.)
Dr. Heidemarie Haeske-Seeberg
Medhochzwei-Verlag, Heidelberg
Noch immer werden in Deutschland zu viele Eingriffe stationär vorgenommen. Das soll sich nun ändern. Nach mehreren Anläufen in der Vergangenheit soll mit der Erweiterung des AOP-Kataloges und der Einführung von Hybrid-DRG der Umschwung geschafft werden. Dabei gilt es jedoch, auf verschiedenen Ebenen für Qualität und Transparenz zu sorgen. Noch hat der Gesetzgeber erkennbar keine Vorgaben verabschiedet,um Steuerungsmöglichkeiten für eine flächendeckende und sichere Versorgung zu gewährleisten. Auch in den zunehmend entstehenden Netzwerkstrukturen ist Transparenz über Prozesse und Ergebnisse essenziell. Im Rahmen der Krankenhausreform wurde als neue Möglichkeit der Patientenbehandlung die „Tagesstationäre Behandlung“ eingeführt. Sie soll – so das Ziel – die Möglichkeiten der ambulanten Behandlung sinnvoll ergänzen. Zahlreiche Vorgaben sind damit verbunden, die es dabei zu beachten gilt. Nicht zuletzt gilt es bei der praktischen Umsetzung in den einzelnen Gesundheitseinrichtungen zahlreiche bestehende Vorgaben zu beachten und die neuen Versorgungsformen mit Blick auf die Patientensicherheit und die Wirtschaftlichkeit umzusetzen.
Dieses Buch zeigt die gesetzlichen und untergesetzlichen Vorgaben verständlich auf und beschreibt die damit verbunden Anforderungen an die Qualitätssicherung in Theorie und Praxis.
ISBN: 978-3-98800-088-0
www.medhochzwei-verlag.de/shop
Zur Bestellung gelangen Sie HIER

Robotik in der Gesundheitswirtschaft – Einsatzfelder und Potenziale
2. überarbeitet und erweiterte Auflage
Rhön Stiftung (Hrsg.)
Prof. Dr. phil. Barbara Klein, Dr.-Ing. Dipl.-Inf. Birgit Graf, Dr. phil. Karin Röhricht, Marina Ringwald, M. A., Melanie Schmidt, Prof. Dr. Inga Franziska Schlömer, Dipl.-Kfm. Holger Roßberg
Medhochzwei-Verlag, Heidelberg
Die demografischen Veränderungen und der Fachkräftemangel sind große Herausforderungen für unsere Gesundheitsversorgung. Robotische Assistenzsysteme können perspektivisch dazu beitragen, das Personal in (teil-)stationären und ambulanten Versorgungsstrukturen zu entlasten. Auch in der eigenen Häuslichkeit können Assistenzroboter Menschen mit Pflegebedarf unterstützen.
Die zweite Auflage von „Robotik in der Gesundheitswirtschaft“ gibt eine Übersicht zum aktuellen Stand der Technik robotischer Lösungen für die genannten Nutzergruppen und Einsatzfelder. Die Ausführungen der ersten Auflage werden dabei um relevante (Weiter-)Entwicklungen der letzten Jahre ergänzt. Neue Produkte gibt es beispielsweise im Bereich der Exoskelette, insbesondere für Anwendungsfelder außerhalb der Rehabilitation. Einige robotische Assistenzsysteme, wie am Rollstuhl angebrachte Roboterarme (Greifhilfen), wurden inzwischen in das Hilfsmittelverzeichnis der gesetzlichen Krankenversicherung aufgenommen.
Ein weiteres Einsatzfeld mit vielen neuen Produkten ist die roboterbasierte Reinigung und Desinfektion. Daneben sind in den letzten Monaten diverse Transport- und Servierroboter, u.a. für Hotel und Gastronomie, auf den Markt gekommen, die vereinzelt auch schon in Einrichtungen des Gesundheitswesens eingesetzt werden.
Aufbauend auf diesem Stand der Technik wird der Einsatz robotischer Assistenzsysteme in der Praxis anhand von Interviews mit Vertretern verschiedener Nutzergruppen beispielhaft dargestellt. Schließlich werden die Potenziale der Robotik für das deutsche Gesundheitswesen aufgezeigt, Szenarien für verschiedene Einsatzfelder sowie für die Unterstützung eines selbstständigen Lebens zu Hause diskutiert und Handlungsempfehlungen abgeleitet.
Das Buch gibt Akteuren des Gesundheitswesens Vorstellungen und Ideen für den aktuellen und zukünftigen Einsatz von Robotik.
ISBN: 978-3-86216-928-3
www.medhochzwei-verlag.de/shop
Zur Bestellung gelangen Sie HIER
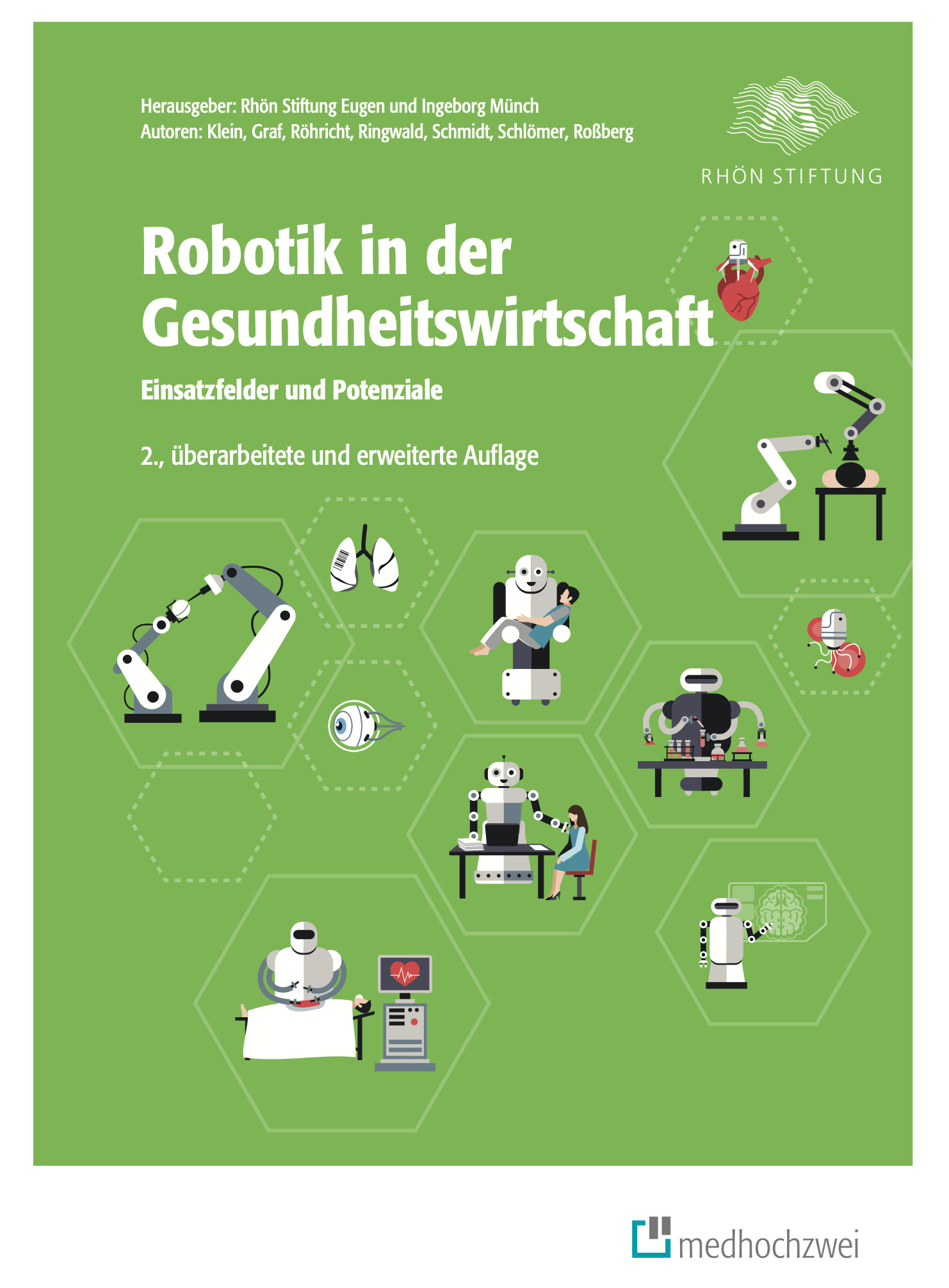
Die elektronische Patientenakte und das europäische Datenschutzrecht
Möglichkeiten zur datenschutzkonformen Ausgestaltung elektronischer Patientenaktien im europäischen Rechtsvergleich
Stiftung Münch (Hrsg.)
Christoph Krönke, Vanessa Aichstill
Medhochzwei-Verlag, Heidelberg
In internationalen Vergleichen zum Thema E-Health schneidet Deutschland regelmäßig auffallend schlecht ab, besonders gegenüber anderen europäischen Staaten. Der Diskurs über E-Health ist in Deutschland stark von datenschutzrechtlichen Fragestellungen dominiert, die eigentlichen Chancen, die sich aus der Digitalisierung für eine qualitativ hochwertige und breite medizinische Versorgung ergeben können, bleiben dagegen im Hintergrund. Bemerkenswert ist dies insofern, als in Europa spätestens seit Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ein vollharmonisiertes Datenschutzrecht gilt.
Die Autoren gehen daher der Frage nach, ob die DSGVO in den EU-Mitgliedstaaten in Gesundheitsfragen unterschiedlich gehandhabt wird, und ob die unter der DSGVO prinzipiell mögliche Gesundheitsdatenverwaltung in Deutschland richtig und vollständig implementiert wird. Grundlage und Gegenstand des Vergleichs bilden die Regelungen über die elektronischen Gesundheitsakten in den digitalen „Vorreiterstaaten“ Österreich, Estland und Spanien, die den jüngst ins Werk gesetzten deutschen Regeln über eine elektronische Patientenakte (ePA) gegenübergestellt werden.
Der Vergleich legt nahe, das deutsche Konzept der ePA zu überdenken: Der deutsche Gesetzgeber hat es in zentralen Punkten versäumt, ein wirksames Patientenaktensystem zu schaffen, das die Spielräume der DSGVO voll ausschöpft. Stattdessen hat er ein paternalistisches Konzept implementiert, das Gefahr läuft, seine oberste Leitlinie – die Patientensouveränität – ins Gegenteil zu verkehren.
ISBN: 978-3-86216-618-3
www.medhochzwei-verlag.de/shop
Zur Bestellung gelangen Sie HIER
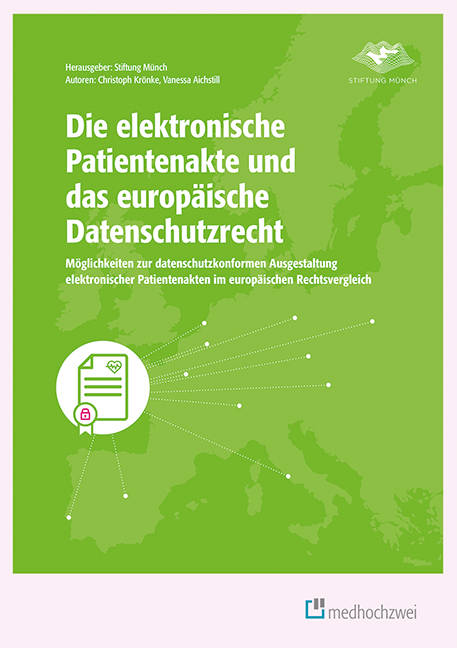
Prospektive regionale Gesundheitsbudgets
Internationale Erfahrungen und Implikationen für Deutschland
Stiftung Münch (Hrsg.)
Benstetter, Lauerer, Negele, Schmid
Medhochzwei-Verlag, Heidelberg
Alle Menschen wollen an den sich schnell erweiternden Möglichkeiten, die Gesundheit wiederherzustellen, zu erhalten und zu bessern, in gleicher Weise teilhaben können. Die Diskussion um steigende Ausgaben für Gesundheit, Rationierung von Leistungen, Fachkräftemangel und Disparitäten im Zugang zur Versorgung zeigt aber: Dieses Versprechen steht in Frage.
Eine besser koordinierte, stärker patientenzentrierte und intersektoral angelegte Versorgung kann Teil der Lösung sein, das Versprechen weiter zu halten. Voraussetzung hierfür ist ein Vergütungssystem, das die Sektorengrenzen tatsächlich überwinden kann und Qualität belohnt. Internationale Erfahrungen zeigen, dass sogenannte Capitation-Modelle, die auf leistungsunabhängigen und sektorenübergreifenden Pro-Kopf-Pauschalen beruhen, Anreize für eine derartige Versorgung schaffen können. In solchen Modellen übernehmen Leistungserbringer einen Teil des Versicherungsrisikos bzw. der finanziellen Verantwortung für Leistungen, die direkt von ihnen erbracht, veranlasst oder nicht vermieden werden. Das Potenzial ist deutlich sichtbar. Allerdings gibt es auch Herausforderungen und Risiken, die mit einem derartigen System einhergehen und entsprechend zu adressieren bzw. zu kontrollieren sind.
Deshalb prüft das vorliegende Buch differenziert die Voraussetzungen und Potenziale des Transfers eines derartigen populationsorientierten Vergütungsansatzes nach Deutschland und zeigt die Optionen einer möglichen Umsetzung in Form prospektiver regionaler Gesundheitsbudgets auf. Die Basis hierzu bildet eine fundierte Analyse von Modellen aus Spanien, Peru, den USA und der Schweiz.
ISBN: 978-3-86216-618-3
www.medhochzwei-verlag.de/shop
Zur Bestellung gelangen Sie HIER
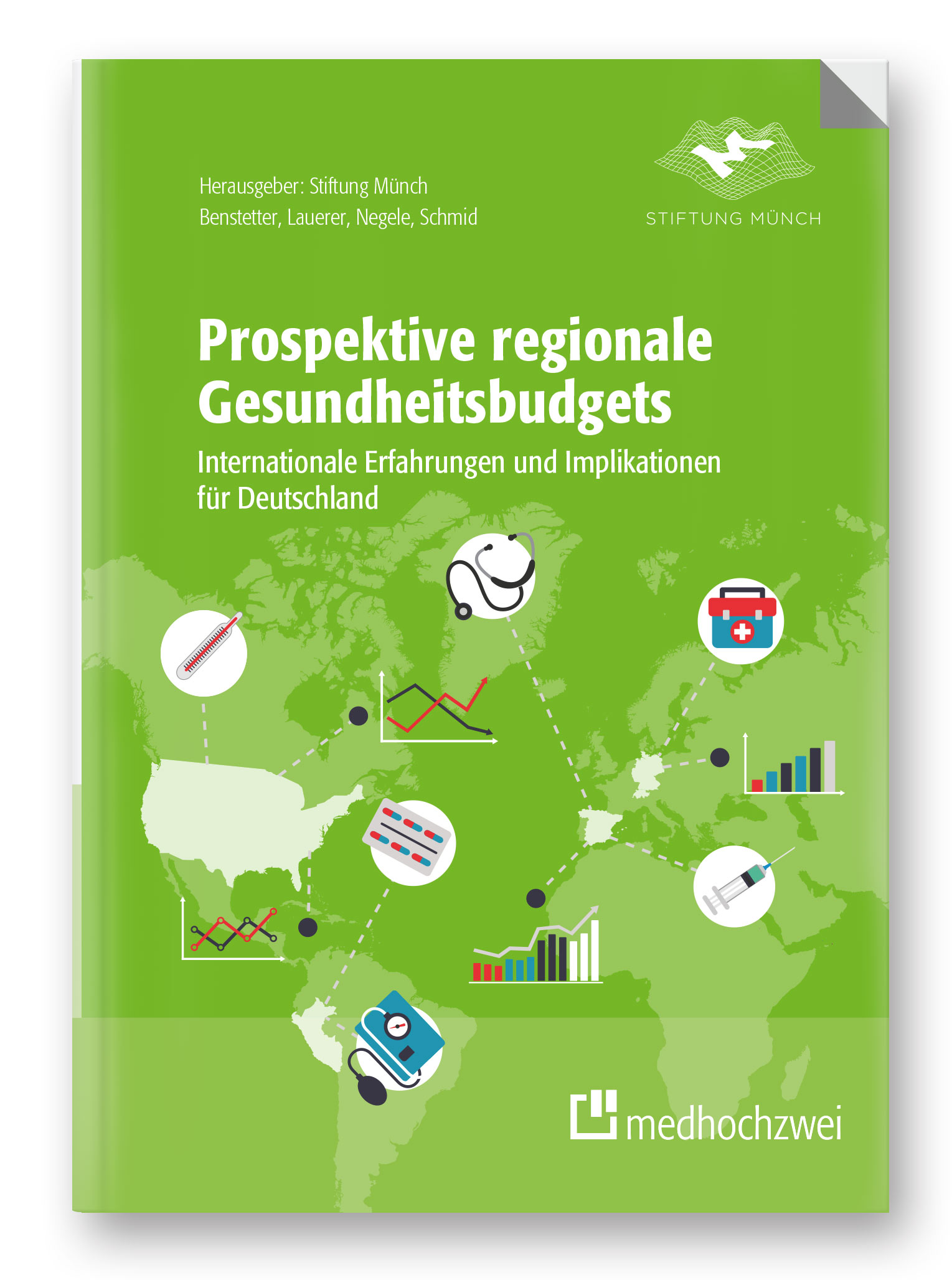
Pflege in anderen Ländern: Vom Ausland lernen?
Stiftung Münch (Hrsg.)
Lehmann, Schaepe, Wulff, Ewers
Medhochzwei-Verlag, Heidelberg
Das Thema Pflege gewinnt in Deutschland zunehmend an Brisanz. Die Gründe dafür sind vielfältig und komplex. Unstrittig ist, dass die Arbeitsbedingungen für die Pflege verbessert werden müssen. Auch die Qualifizierung und Kompetenzprofile sind zu modernisieren. Darüber, wie diesem Reformbedarf erfolgreich begegnet werden kann, wird derzeit intensiv diskutiert, unter anderem im Rahmen der ressortübergreifenden „konzertierten Aktion Pflege“ der Bundesregierung.
Bei der Suche nach Lösungswegen könnte womöglich ein Blick in andere Länder helfen: Wie ist die Pflege in anderen Ländern organisiert und wie wird dort auf den steigenden Bedarf an pflegerischen Versorgungsleistungen reagiert? Wie sind Aufgaben und Verantwortlichkeiten zwischen den verschiedenen Gesundheitsberufen verteilt und welche Aus- und Weiterbildungswege gibt es? Welche innovativen Konzepte zur Berufstätigkeit in der Pflege und zur Sicherung der pflegerischen Versorgung in den verschiedenen Settings sind erkennbar? Werden moderne Technologien, Digitalisierung und Robotik genutzt, um Pflege zu unterstützen?
Diesen und ähnlichen Fragen geht eine Untersuchung der Stiftung Münch nach, die am Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaft der Charité – Universitätsmedizin Berlin durchgeführt wurde. Sie analysiert die Situation in Großbritannien, Schweden, den Niederlanden und Kanada und leitet daraus Handlungsempfehlungen für Deutschland ab.
ISBN: 978-3-86216-536-0
www.medhochzwei-verlag.de/shop
Zur Bestellung gelangen Sie HIER

Robotik in der Gesundheitswirtschaft
Einsatzfelder und Potenziale
Stiftung Münch (Hrsg.)
Klein, Graf, Schlömer, Roßberg, Röhricht, Baumgarten
Medhochzwei-Verlag, Heidelberg
Die demografischen Veränderungen und der daraus resultierende Fachkräftemangel gehören zu den bedeutendsten gesellschaftlichen Herausforderungen. Es sind Lösungen gefragt, die das Personal sowohl in stationären als auch ambulanten Versorgungsstrukturen entlasten, um so eine weiterhin hohe Qualität in der Gesundheitsversorgung und Pflege zu ermöglichen. Doch auch hilfe- und pflegebedürftige Menschen benötigen Unterstützung für ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden.
Robotik-Technologien bieten hierfür vielfältige Potenziale. Die Studie “Robotik in der Gesundheitswirtschaft: Einsatzfelder und Potenziale” lotet die aktuellen und perspektivischen Einsatzmöglichkeiten aus. Welche Szenarien sind in den kommenden Jahren realistisch und von der Branche gewünscht? Welche Hürden stehen dem Einsatz von Robotik im Gesundheitswesen entgegen und welche Voraussetzungen müssen dementsprechend geschaffen werden? Auf diese Fragen zeigt die Studie mögliche Antworten auf.
Das Buch gibt eine Übersicht über den Stand der Technik robotischer Lösungen und Entwicklungen für die Einsatzfelder Krankenhaus, Rehabilitation, Altenpflege sowie zur Unterstützung des selbständigen Lebens in der eigenen Häuslichkeit. Japan und Korea gelten als Vorreiter im Bereich innovativer Robotik. Der Stellenwert der dortigen Ansätze im Gesundheitswesen wird von den Autoren beleuchtet. Darauf aufbauend zeigt die Studie Potenziale der Robotik für das deutsche Gesundheitswesen und entwirft Szenarien für die Jahre 2020 und 2030 für Einsatzfelder im Krankenhaus, in der Rehabilitation, in der stationären und ambulanten Pflege sowie für die Unterstützung eines selbständigen Lebens zu Hause. Auf der Basis der Auswertungen von Expertengesprächen werden Handlungsempfehlungen für die Akteure im Gesundheitswesen abgeleitet, wie ein zweckmäßiger Einsatz von Servicerobotik im Gesundheitswesen umgesetzt werden kann.
Grundlage für die Studie sind eine umfangreiche Marktrecherche, die über 170 Robotersysteme berücksichtigt, sowie Experteninterviews und Fokusgruppengespräche mit 27 Personen.
Das Buch dient als Anregung für die Akteure des Gesundheitswesens, um Vorstellungen und Ideen für den zukünftigen Einsatz von Robotik zu finden.
ca. 170 Seiten
ISBN: 978-3-86216-388-5
www.medhochzwei-verlag.de/shop
Zur Bestellung gelangen Sie HIER
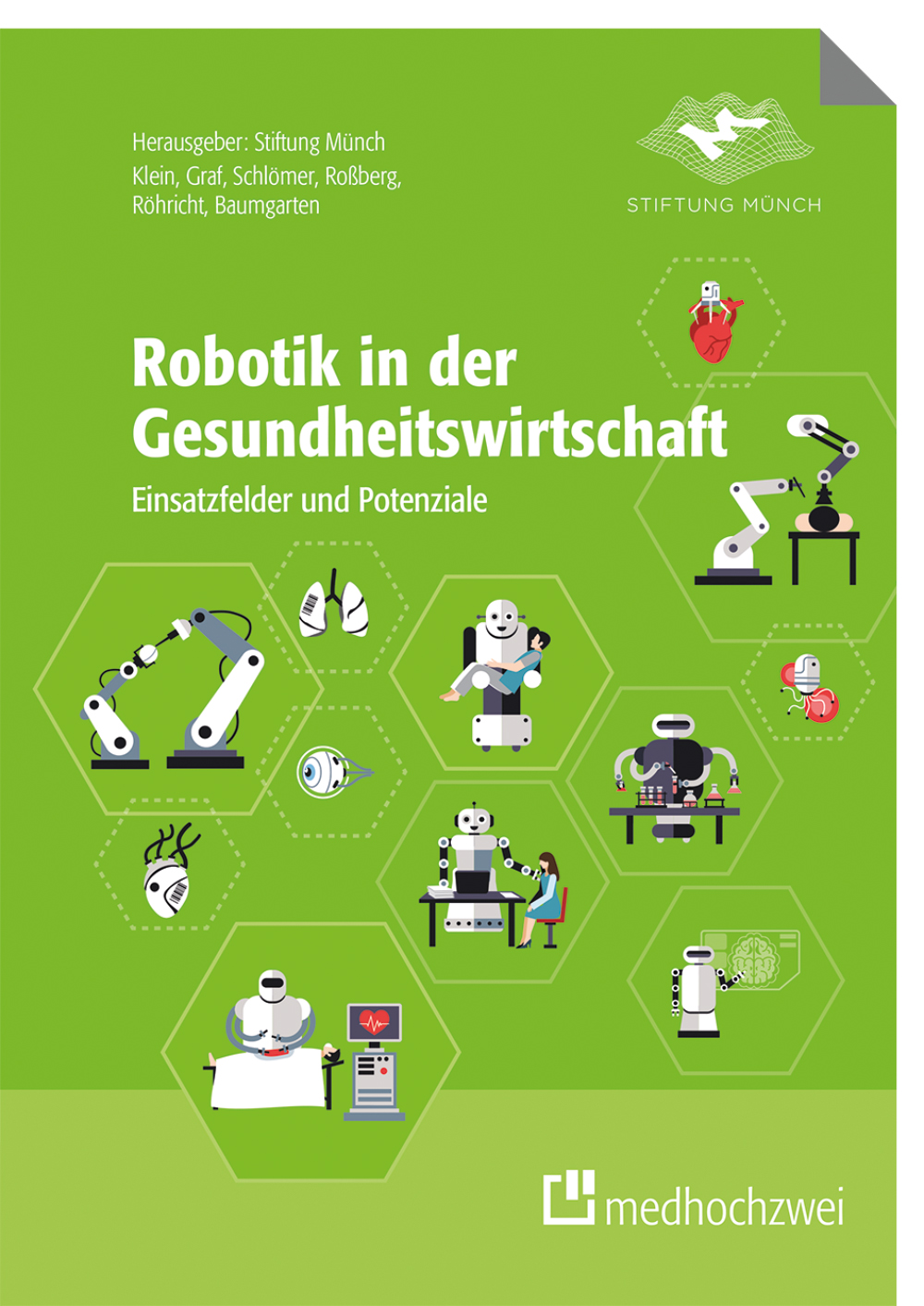
Die elektronische Patientenakte –
Fundament einer effektiven und effizienten Gesundheitsversorgung
Stiftung Münch (Hrsg.)
Amelung, Chase, Urbanski, Bertram, Binder (2016)
Medhochzwei-Verlag, Heidelberg
Dass eine elektronische Patientenakte (ePA) die Effektivität und Effizienz der Versorgung steigern kann, wird heutzutage kaum mehr in Frage gestellt. Sie bietet ein breites Anwendungsspektrum für Patienten, Leistungserbringer und Krankenkassen gleichermaßen. Sie führt zu effizienteren Arbeitsprozessen, verringert die administrative Belastung des medizinischen Personals und verbessert außerdem die Versorgung durch die Nutzung entscheidungsunterstützender Systeme. Auch unnötige (Doppel-) Untersuchungen und Folgebehandlungen werden reduziert. Erhalten Patienten Zugriff auf ihre Daten, wird zudem ihre Gesundheitskompetenz gestärkt.
Doch obwohl die Vorteile einer ePA auf der Hand liegen, hat diese nach wie vor den Eingang in das deutsche Gesundheitswesen nicht geschafft – im Gegensatz zu anderen Ländern.
Wie ist die ePA in Dänemark, Israel, den USA und Österreich ausgestaltet, die als Vorreiter gelten? Welche Rolle können von Unternehmen wie Apple oder Google entwickelte ePA spielen? Welche Schlussfolgerungen können für Deutschland gezogen werden? Und wo steht die Implementierung der hiesigen ePA im europäischen Vergleich? Diesen Fragen geht das Buch auf den Grund.
ca. 120 Seiten, 59,99 €
ISBN: 978-3-86216-331-1
www.medhochzwei-verlag.de/shop
Zur Bestellung gelangen Sie HIER
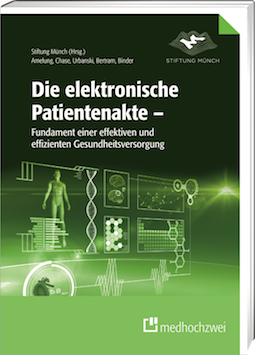
Netzwerkmedizin
Fakten. Diskurs. Perspektiven für die praktische Umsetzung
Stephan Holzinger, Boris Augurzky (2015). medhochzwei-Verlag, Heidelberg
Das Gesundheitssystem ist in seiner bisherigen Form nicht zukunftsfähig: durch die Alterung der Gesellschaft nehmen immer mehr Menschen
Leistungen in Anspruch, während immer weniger Menschen diese Leistungen bezahlen und ausführen.
Eugen Münch hat mit seinem Konzept der Netzwerkmedizin einen unternehmerischen Wurf
in die Diskussion eingebracht, mit dem die drohende Rationierung im Gesundheitswesen verhindert werden soll. Die Kernelemente sind bundesweite Netzwerke von Leistungsanbietern aller Versorgungsstufen, die Einführung der elektronischen Patientenakte und ein neuartiges Versicherungsangebot. Das Angebot richtet sich konsequent auf die Bedürfnissen der Patienten aus und zielt vor allem auf gesetzlich Versicherte.
Der Band „Netzwerkmedizin – Fakten. Diskurs. Perspektiven für die praktische Umsetzung“ konkretisiert das Konzept der Netzwerkmedizin und ist daher als Fortsetzung zum ersten Band „Netzwerkmedizin – Ein unternehmerisches Konzept für die altersdominierte Gesundheitsversorgung“ zu verstehen. Es enthält detaillierte Beschreibungen und Hintergrundinformationen zu den tragenden Säulen der Netzwerkmedizin. Zu vielen bedeutsamen Aspekten beziehen Experten kritisch und konstruktiv Stellung.
Das Buch dient als Diskussionsgrundlage für alle, die sich mit dem Gesundheitswesen und seiner Zukunft auseinandersetzen und nach gangbaren Alternativen suchen.
Ca. 170 Seiten. Softcover. € 59,99.
ISBN 978-3-86216-246-8
www.medhochzwei-verlag.de/shop
Zur Bestellung gelangen Sie HIER
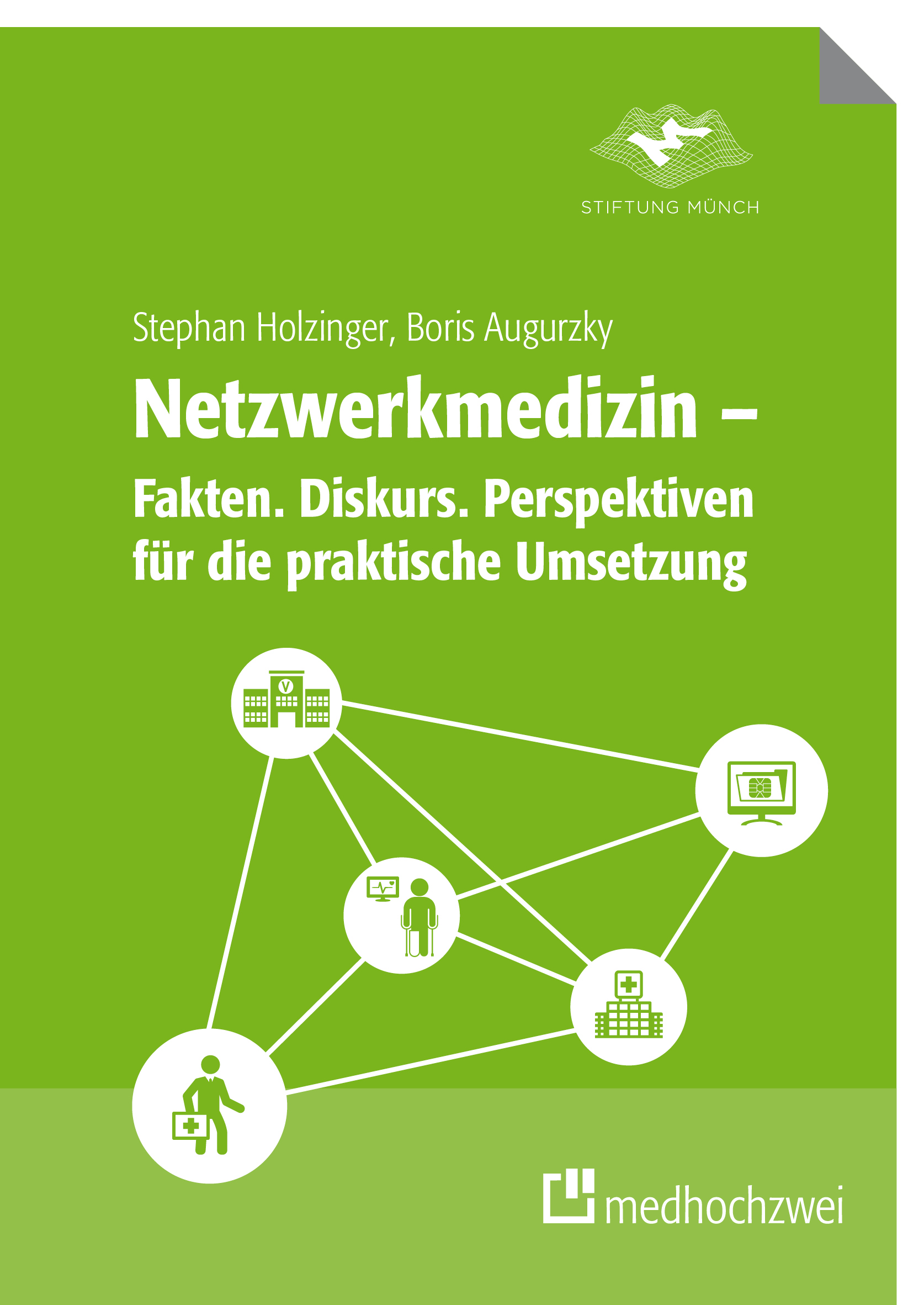
Netzwerkmedizin
Ein unternehmerisches Konzept für die altersdominierte Gesundheitsversorgung
E. Münch und S. Scheytt (2014). Springer Gabler Verlag, Wiesbaden.
Das von Eugen Münch entwickelte Netzwerkmedizin-Konzept ist ein konkreter Ansatz für die dringend erforderliche Weiterentwicklung des Gesundheits- und Krankenhauswesens. Das Thema hat zwar in jüngster Zeit eine Resonanz in den Medien erfahren – aber nur ein Buch kann die weitergehenden Überlegungen ganzheitlich darstellen und erklären. Die Netzwerkmedizin ist ein unternehmerischer Impuls, kein politischer. Und so ist dieses Buch – inmitten der seit Jahren immer wieder aufflammenden Diskussionen um die angebliche Unvereinbarkeit von Medizin und Ökonomie – eben kein Rückblick auf das Erfolgte und Geleistete, sondern eine persönliche Streitschrift für ein besseres Gesundheitswesen. Bestandteil des Konzepts ist die im Buch ausführlich dargestellte Assekurante Krankenversicherung (AKV). Kernstück ist ein bundesweites Krankenhausnetzwerk in Verbindung mit einer oder mehreren gesetzlichen Krankenkassen, ergänzt um private Zusatzkrankenversicherungen. Gemeinsam garantieren sie eine flächendeckende medizinische Vollversorgung auf höchstem Niveau. Es geht dabei nicht in erster Linie um Synergien zwischen zwei oder mehreren großen Krankenhausketten oder um zusätzliche Rationalisierung in einzelnen Krankenhäusern, sondern um einen ganz neuen Weg für das deutsche Gesundheitswesen, um eine neue Perspektive gerade für Kassenpatienten – mithin um die Einebnung einer Zwei-Klassen-Medizin.
ISBN 978-3-658-04456-5